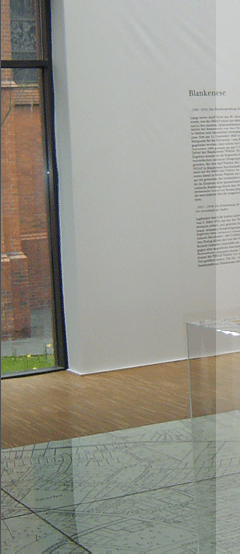|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
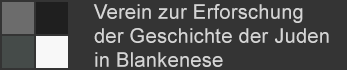 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
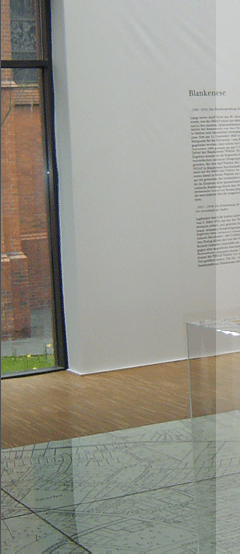 |
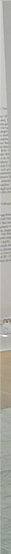 | 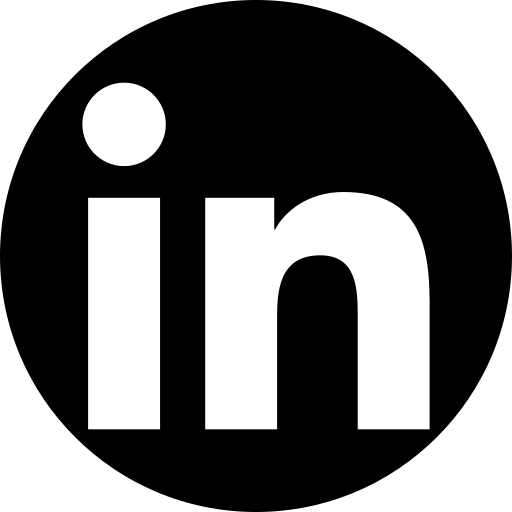
 [zurück...] [zurück...]
Historisch-politischer Vortrag
Blankenese im 3. Reich -
Schicksale, Vereine, Schulen, Kirche, Musik, Projekte
Moderation Hannes Heer
Mittwoch, 12. Mai (20 Uhr, in der Evangelischen Kirche, Eintritt frei)
PROGRAMM
Hebräische Lieder, u.a. aus Hava Nashira (Lasst uns Singen): Liederbuch für die jüdische Jugend (1935)
Hinematov (Psalm 133, Siehe wie gut und wie schön, wenn Brüder in Eintracht leben), Schalom Chaverim (Frieden Freunde), Havana Gila (Wir wollen uns freuen), Hashivenu (Führ uns zurück), In deinen Toren Jerusalem
Blankenese im Dritten Reich
Eine Zwischenbilanz der aktuellen Forschung zur Geschichte Blankeneses im Nationalsozialismus, auf der Grundlage von u.a.
Berichten von Zeitzeugen
Akten des Staatsarchivs
Archiv der Norddeutschen Nachrichten 1929-1943
Dokumenten der Evangelischen Kirchengemeinde
Mitgliederverzeichnissen der Vereine
Protokollen von Vereinssitzungen
Jubiläumsschriften von Schulen
Zwischenbilanz heißt, wir wollen weiter forschen. Wir wünschen uns darum, mit Zeitzeugen aus dem Publikum ins Gespräch zu kommen.
Zukunftsprojekt:
Kooperation zwischen katholischer und jüdischer Grundschule
Stelltafel zur Dehmel-Website: www.richard-dehmel.de
Mitwirkende
Unter anderem:
Ulf Andersen (Schulleiter Christianeum), Chor der Gorch-Fock-Schule (Leitung: Birte Fankhänel und Martin Konerding), HansJürgen Höhling (Geschichtslehrer Gymnasium Blankenese), Vera Klischan (Schulleiterin Gorch-Fock-Schule), Martin Konerding (stellvertretender Schulleiter Gorch-Fock-Schule), Dr. Klaus Krupp (Schulleiter Katholische Schule Blankenese), Dr. Marion Rollin (Journalistin), Eva-Maria Schattauer (Gymnasium Blankenese, Grundkurs Geschichte, 2. Semester), Maximilian Robert Scheer (Gymnasium Blankenese, Grundkurs Geschichte, 2. Semester), Dr. Martin Schmidt (Vorsitzender des Vereins zur Erforschung der Geschichte der Juden in Blankenese), Jochen Stüsser-Simpson (Deutschlehrer Christianeum).
Einleitung und Moderation: Hannes Heer
Zur Veranstaltung
Der NSDAP fiel Deutschland nicht durch einen Putsch - durch die Machtergreifung am 30.1.1933 - in die Hand. Lange bevor Adolf Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wurde, war die NSDAP schon zur stärksten Partei im Reichtag und in den meisten deutschen Länderparlamenten geworden. Auch in Blankenese wurden die Nazis bei den fünf Wahlen des Jahres 1932 zur stärksten politischen Kraft am Ort. Diese Machtstellung spiegelte sich auch im gesellschaftlichen Leben wider und wurde sichtbar, als im Frühjahr 1933 die nationalsozialistische Revolution, also der innere Umbau von Staat und Gesellschaft auch in Blankenese einsetzte: Die Vereine und Berufsverbände stellten sich freiwillig auf den Boden des neuen Staates und praktizierten Arierparagraph und Führerprinzip, die evangelische Kirchengemeinde war mit ihren beiden Pfarrern ein fester Stützpunkt der nazinahen Deutschen Christen und machte die neue Staatspartei auch beim bürgerlichen Publikum salonfähig, die Schulen wurden - von politisch unzuverlässigen Elementen gesäubert - zur ersten Station einer nationalsozialistischen Erziehung zu Rassenbewusstsein und soldatischem Charakter. All das geschah von Beginn an mit deutlicher Frontstellung gegen den Teil der Bevölkerung, der als jüdisch stigmatisiert und in der Folge ausgegrenzt, isoliert, beraubt, physisch verfolgt und zur Vernichtung bestimmt wurde.
Die Veranstaltung will die Nazifizierung Blankeneses, die ein solches Verbrechen an Nachbarn und Freunden ermöglichte, genauer ausloten - in Übersichtsbeiträgen, an Fallbeispielen, mit biographischen Skizzen und, so hoffen wir, auch anhand von Erfahrungsberichten von Zeitzeugen aus dem Publikum. Wir werden auch die Spielräume ausleuchten, die Menschen nutzten, um den plötzlich zu Volksfeinden erklärten jüdischen Mitbürgern zu helfen und in einigen Fällen sogar zu retten. Ohne der Abschlussveranstaltung am 18. Mai vorgreifen zu wollen, bietet die Diskussion natürlich auch die Möglichkeit, danach zu fragen, was mit diesem gesammelten historischen Wissen über Blankenese in Zukunft geschehen soll.
Hannes Heer
Historiker und Filmregisseur in Hamburg, geb. 1941, Staatsexamen in Geschichte und Literaturwissenschaft 1968 an der Universität Bonn; Berufsverbot; Rundfunkautor, Lehrbeauftragter an den Universitäten Bremen und Hamburg, Dramaturg am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und an den Städtischen Bühnen Köln; Dokumentarfilme für ARD und ZDF; 1993 - 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung und Leiter der ersten Wehrmachtsausstellung; 1997 Träger der Carl-von-Ossietzky-Medaille; zahlreiche Publikationen zur Geschichte von Nationalsozialismus, Krieg und Nachkriegserinnerung, zuletzt: Wie Geschichte gemacht wird. Zur Konstruktion von Erinnerungen an Wehrmacht und Zweiten Weltkrieg (Hg. mit Walter Manoschek u.a.), Wien 2003; Vom Verschwinden der Täter. Der Vernichtungskrieg fand statt, aber keiner war dabei, Berlin 2004; als Mitarbeiter der Agentur exhibit zusammen mit Petra Bopp Konzeption und Organisation der Ausstellung Viermal Leben.
....................................................................................................................................................
Abschlussveranstaltung: Wie geht es weiter?
Resümee und Ausblick - mit Historikern und Politikern
Dienstag, 18. Mai, 20 Uhr
Evangelische Kirche, Mühlenberger Weg 64
Eintritt frei
....................................................................................................................................................
Vortrag von Marion Rollin
„Gott schuf keine Stände, keine Klassen, aber Rassen“ - Einblicke in
die Kirchengemeinde Blankenese während der Zeit des Nationalsozialismus
„Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier,
hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus
Christus“, so steht es bei Paulus im Galaterbrief. Welch hehrer
Grundsatz größter Toleranz! Er ist zur Zeit des Nationalsozialismus
mit Füßen getreten worden – auch von der evangelisch-lutherischen
Kirche in Blankenese wurde er zertreten. Das haben wir alle bis vor
wenigen Monaten noch nicht gewusst. Haben nicht gewußt, wie engagiert
sich auch unsere Kirche eingebracht hat, mit welchem Eifer sie sich
mitbeteiligte an der Ausgrenzung, Diffamierung und Ermordung hier im
Ort ansässiger Juden. So das vorläufige Resultat einer Arbeitsgruppe,
die sich, angestoßen von der Ausstellung „Viermal Leben. Jüdisches
Schicksal in Blankenese“ gebildet hat. Ihr Thema: Die Rolle der
Blankeneser Kirche zur NS-Zeit. Historiker, Architekten, ein Pastor,
eine Diplomatin, eine Journalistin und andere haben in hunderten von
ehrenamtlichen Stunden Dokumente gelesen, Predigt-Texte entziffert, in
Zeitungen von damals recherchiert. Wir diskutierten in der Gruppe,
erschraken, stritten, versöhnten uns, waren bewegt, waren sprachlos.
Vielleicht wird es Ihnen ähnlich gehen, wenn Sie gleich hören werden,
welche Fakten zusammengetragen wurden – zusammengetragen vor allem von
dem Historiker Bernhard Liesching, der, als wir Ehrenamt-liche uns
überfordert fühlten, für zwei Monate eingestellt wurde und dem wir
viel Aufklärung zu verdanken haben. Leider kann er heute abend – aus
familiären Gründen - nicht hier sein.
Ich will mit dem Ende des Nationalsozialismus beginnen. Die
evangelische Kirche hatte bei der britischen Besatzungsmacht
nachgesucht, sich selber entnazifizieren zu dürfen. Es war damals ein
ungewöhnliches Entgegenkommen der Briten, daß sie Ja dazu sagten, ein
vertrauensvolles auch. ‚Die Kirchenleute werden schon gründlich bei
sich gucken...’, mögen sie bei sich gedacht haben. Haben sie
gründlich geguckt?
9. März 1946: Das Landeskirchenamt Schleswig-Holsteins weist ihre
Gemeinden zur Entnazifizierung an: Sie sollen alle
Kirchen-Mitglieder, die sich politisch in den Dienst des
National-sozialismus gestellt und sich der Judenverfolgung mitschuldig
gemacht hatten, auffordern, ihr Amt niederzulegen. Zwei Monate
später: Der Vorstand der Blankeneser Kirchengemeinde entschließt sich
gegen eine Entnazifizierung: „Eine Aufforderung zur Amtsniederlegung
ist nicht nötig,“ heißt es im Sitzungs-Protokoll. Unverändert ist ein
halbes Jahrhundert später, 1996, in der Jubiläums-Chronik der
Blankeneser Kirche zu lesen, dass eine Amtsniederlegung in Blankenese
damals nicht erforderlich gewesen wäre. Wirklich nicht?
Wo standen die beiden Blankeneser Pastoren Schetelig und Schmidt:
Probst Wilhelm Schetelig war von 1929 bis 1952 für die Blankeneser
Gemeinde zuständig, Pastor Richard Schmidt von 1931 bis 1946. Es geht
nicht darum, anzuklagen, sich besserwisserisch aus der historischen
Distanz von 60, 70 Jahren zu empören: ‚Wie konnten die nur...’ Wir
sind damals nicht dabei gewesen, und niemand von uns könnte sagen, wie
er sich verhalten hätte, wenn er als Pastor hier gestanden hätte.
Bonhoeffers und Niemöllers, die Widerstand leisteten und dabei ihr
Leben riskierten, gab es ja kaum. Wir wollen also nicht denunzieren,
aber wir wollen und müssen genau wissen, was war, um daraus für die
Zukunft lernen zu können. Wer die Vergangenheit nicht kennt, bleibt
ihr unbewusst verhaftet. Nur wer sich ihr einmal mutig gestellt hat,
kann authentisch und offen nach vorne leben.
Blankenese 1933: Frappierend, wie schnell sich die hiesige Kirche der
NSDAP näherte. Bereits vor Hitlers Machtergreifung war Propst
Schetelig dem sogenannten „Opferring“ beigetreten, einer
Organisation, die die Partei finanziell und ideell unterstützte.
Geradezu euphorischer Jubel dann nach Hitlers Sieg. Schetelig in der
Gemeinde-Chronik: „Wie ein Aufatmen nach langem, bangem Druck ging es
durch die ganze Gemeinde, als am 30. Januar 1933 der Reichspräsident
Feldmarschall von Hindenburg Adolf Hitler mit dem Posten des
Reichskanzlers betraute und die NSDAP die Führung übernahm. Unter uns
war der Dank lebendig und ehrlich für alles, was Gott unserem Volke
durch unseren Führer geschenkt hatte.“ Auch Pastor Schmidt predigt
nach der Machtergreifung erleichtert über Erlösung aus lange
erlittener Schmach: „Aus deutscher Not ist in nationaler Besinnung
eine deutsche Freiheitsbewegung erwachsen. Volkstum und Vaterland
werden wieder als hohe, von Gott geschenkte Güter erkannt.“ Wieso
solch schnelle Liaison mit den Nazis?
Um zu verstehen, müssen wir einordnen. Angelegt war die Euphorie, mit
der Schmidt und Schetelig Hitler begrüßten, schon lange vor der
Machtergreifung, nämlich 1918. Wie nahezu alle Pastoren waren auch sie
vom Kaiserreich geprägt: deutsch-national, obrigkeitshörig,
kaisertreu. Der Friedensvertrag von Versaille: eine Schande für sie.
Der Weimarer Staat und die ihn tragenden Parteien: Religionsfeinde.
„Mit Freude“, so Schetelig, „stelle ich fest, dass bei der Bekämpfung
der Gottlosen (er meint die Sozialdemokraten und die Kommunisten) die
NSDAP das größte Verdienst gehabt hat.“ Welch mörderischer Irrtum das
war, konnte er damals noch nicht ahnen.
Doch es kam der nächste Schritt: Schmidt und Schetelig waren von der
ersten Stunde an Mitglieder der nazinahen Glaubensbewegung der
Deutschen Christen. Bereits auf ihrer ersten Tagung im April 33
bekannten sie sich einmütig zu „Blut und Rasse“. Es heißt in ihrem
Papier: „Weil die deutsche Volkskirche die Rasse als Schöpfung Gottes
achtet, erkennt sie die Forderung, die Rasse rein und gesund zu
erhalten, als Gottes Gebot. Sie empfindet die Ehe zwischen Angehörigen
verschiedener Rassen als Verstoß gegen Gottes Willen.“ Unverblümt
benennen die Deutschen Christen im selben Papier den Grund ihrer
Aversion gegen Juden: „Wir erkennen im Alten Testament“, schreiben
sie, „den Abfall der Juden von Gott und darin ihre Sünde. Diese Sünde
wird vor aller Welt offenbar in der Kreuzigung Jesu. Von da her lastet
der Fluch Gottes auf diesem Volke bis zum heutigen Tage.“ Schon hier
stockt einem der Atem. Es liest sich für uns Nachgeborenen, die wir
das grausame Ende kennen, wie die Chronik eines angekündigten
Mordens.
Wieso sind Schetelig und Schmidt nicht bereits hier stutzig geworden?
Wieder müssen wir einordnen, um zu verstehen. Der Antijudaismus ist
keine Erfindung der Nationalsozialisten, sondern der Chronisten des
Neuen Testaments – des Markus, des Lukas, vor allem aber von Matthäus
und von Johannes. Der von ihnen geschürte Hass auf die Juden, die
angeblichen Gottesmörder, steigerte sich im Laufe der Jahrhunderte ins
Maßlose. „Von den Jüden und ihren Lügen“ heißt eine Schrift Martin
Luthers, in dem der große Reformator im Jahr 1543 gegen die Juden in
einer Weise herzog, die bereits stark an nationalsozialistisches
Vokabular erinnert. Sieben praktische Regeln nennt er darin, wie
Christen mit Juden umzugehen hätten. Ich zitiere wörtlich Martin
Luther:
„Erstlich, das man jre Synagoga oder Schule mit feur anstecke...
Zum andern, das man auch jre Heuser des gleichen zerbreche und
zerstöre...
Zum dritten, das man jnen neme alle jre Betbüchlein und Talmudisten...
Zum Vierden, das man jnen Rabinen bei leib und leben verbiete,
hinfurt zu leren...
Zum Fünfften, dass man den Jüden das Geleid und Strasse gantz und
gar auffhebe...Sie sollen daheime bleiben...
Zum Sechsten, das man jnen den wucher verbiete und neme jnen alle
barschafft und Kleinot an silber und Gold...
Zum Siebenden, das man den jungen Jüden in die hand gebe flegel, axt,
karst...und lasse sie jr brot verdienen im schweis der nasen...“
Synagogen verbrennen, Schulen anzünden, Privathäuser zerstören,
Bibeln, Schmuck und Geld konfiszieren: Der von Luther noch religiös
begründete Antijudaismus der Kirche war, das ist inzwischen
unbestritten, einer der tragenden Stützpfeiler für den rassistischen
Antisemitismus der Nationalsozialisten. Wer über Jahrhunderte kein
einziges gutes Haar an den Juden ließ, der ist, wenn andere sie zu
Tode hetzen wollen, offener und anfälliger dafür, sich der hetzenden
Meute anzuschließen.
Mai 1933: Die Deutschen Christen versammeln sich im Blankeneser
Gemeindesaal. Pastor Schmidt nennt - ich zitiere die Norddeutschen
Nachrichten – „in seiner warmen und herzlichen Art die
nationalsozialistische Bewegung ein Gottesgeschenk“. Die Versammlung
schließt mit einem Sieg-Heil auf Führer und Volk. Man kann es deutlich
verfolgen: Die Umarmung zwischen Kirche und Partei wird immer enger.
Wie eng, zeigen die Feiern zur Lutherwoche in der Blankeneser Kirche
im November 1933. Man hat den Landesbischof von Schleswig-Holstein,
Paulsen, für den Festvortrag gewinnen können. „Der mächtige Elbstrom
dort unten am Blankeneser Ufer“, hebt Paulsen salbungsvoll an, „kann
uns als Sinnbild dienen für das Werden und Wachsen einer großen
geistigen Bewe-gung wie die Adolf Hitlers. Er selbst ist der Quell des
gewaltigen breiten Stromes...“ Hitler hier also bereits als Schöpfer.
Wie sehr die Kirche dazu beigetragen hat, Hitler zum Gott zu erhöhen,
wird immer offenkundiger. Interessant und erschreckend zugleich, dies
am kleinen Beispiel der Blankeneser Kirche genau beobachten zu können
- ein Mikrokosmos als Spiegel des Großen. Bigott fährt Bischof Paulsen
in seiner Rede fort: „Das deutsche Volk hat drei Reformationen gehabt:
durch Luther die des Gewissens, durch Lessing die des Wissens und
heute sind wir Zeugen der Reformation der deutschen Seele.“ Und am
Ende dann der unsägliche Vergleich: „Luther hat das Christentum
gerettet, Hitler das Deutschtum. Zwei Ströme verbinden sich
miteinander und münden in die Ewigkeit.“ Welch nationalsozialistisches
Getöse in der Blankeneser Kirche!
Partei und Kirche – die Freundschaft wird geradezu symbiotisch.
November 1933: Pastor Schmidt hält die Predigt zur Totengedenkfeier,
die NSDAP erscheint mit Fahnen in der Blan-keneser Kirche. Am Ende
singt die Gemeinde das Hohe Lied der Nazis. Ich zitiere die erste
Strophe: „Die Fahnen hoch! Die Reihen fest geschlossen. / SA
marschiert in ruhig festem Schritt. / Kameraden, die Rotfront und
Reaktion erschossen, / marschier’n im Geist in unsern Reihen mit.“
Das Crescendo wird wilder. Schmidt und Schetelig aktiv dabei. 31.
Januar 1934. Kirchentag der Propstei Pinneberg, zu der Blankenese
damals gehörte. Schmidt und Schetelig sind anwesend. Landesbischof
Paulsen sagt in seiner Rede: „Die Kirche muß das Volk erobern...“. Und
weiter: „Der Kern des Nationalsozialismus liegt in dem sogenannten
Arierparagraphen, in dem Bekenntnis zur Rasse. Gott schuf keine
Stände, keine Klassen, aber Rassen. Zu diesem schöpfungsmäßigen
Gedanken müssen wir uns bekennen.“ Schetelig spricht anerkennende
Schlussworte. Die Verachtung der Juden wird immer schamloser.
Bald ist es nicht mehr die NSDAP, die um die Kirche wirbt, sondern die
Blankeneser Kirche ist es, die die Nähe zur Partei sucht – und dieses
auch frank und frei äußert. Maifeier 1934, ein Fest der Propaganda für
die Bewegung des Nationalsozialismus. Der 1. Mai wird auch in den
Kirchen der Propstei gefeiert. Doch mit großem Bedauern stellt
Schetelig fest, dass die Verbände der NSDAP nicht überall präsent
waren. Das will er anders haben. Für zukünftige Feiern, so schlägt
Schetelig deshalb dem Landeskirchenamt vor, solle man beim Staat
darauf hinwirken, daß der Gottesdienst immer ein fester Bestandteil
der nationalsozialistischen Maifeiern in seiner Propstei sein solle.
NSDAP und Kirche: Es wird der hiesigen Gemeinde immer schwerer
gemacht, das goldene Kalb der Partei von dem Gott aller Menschen zu
unterscheiden. Die Blankeneser Pastoren haben an solcher Verwirrung
entscheidenden Anteil.
März 1935: Gerhard Tietzen, der als Regimentskamerad Adolf Hitlers
vorgestellt wird, spricht in der überfüllten Blankeneser Kirche zum
Thema: „Martin Luther und Adolf Hitler in ihrem Wirken auf die
deutsche Seele.“ Sein Vortrag kulminiert in dem blasphemischen
Vergleich: „Wie Luther uns auf der Wartburg die deutsche Bibel
schenkte, so schrieb der Führer auf der Festung Landsberg sein
Monumentalwerk ‚Mein Kampf’“. Beifallende Schlussworte von Propst
Schetelig. Wo steht Jesus, wo Gott und wo der Führer? Die Bilder
beginnen, ineinander zu verschwimmen.
Juni 1935: Pastor Jensen wird gebeten, vor der regelmäßig tagenden
Blankeneser Pastoren-konferenz – den Vorsitz hat hier stets Schetelig
– über „die Kirche im Dienste der Sippenforschung“ zu referieren. Es
gebe in Deutschland, sagt Jensen, keine Institution, die der
Sippen-forschung einen besseren Dienst leisten könne, als die Kirche.
Sie bilde dafür geradezu das Fundament, ohne das die Sippenforschung
ihren Namen gar nicht mit Recht tragen dürfe. Die Quellen seien die
Kirchenbücher. Freudig, sagt Jensen, müsse die Kirche sich in den
Dienst der Sache stellen. Die Treibjagd auf die Juden wird
beängstigend. Für die einen. Die anderen, die Treiber, lachen und
danken Gott für ihre gute Laune.
So Pastor Schmidt. März 1936. Heldengedenktag in der Blankeneser
Kirche. Schmidt predigt. „Sehnsüchtig schaute ein Volk aus nach dem
Befreier aus der Not. Da kam der Führer. Aus all dem Zusammenbruch
rettete er hinüber den Glauben, wo nichts mehr zu schauen war, die
Hoffnung, wo nichts mehr zu hoffen war... Ein Wunder ist mit uns
geschehen. Es ward wieder ein neues Volk, das wieder mit frohem Mut an
die Arbeit ging, Menschen konnten wieder lachen, und fröhlich sein...
Denk daran und danke.“ Jener Menschen, für die es nichts mehr zu
lachen gibt, gedenkt Schmidt nicht. Daß er indessen um ihr
jämmerliches, menschenunwürdiges und bedrohtes Leben sehr gut
Bescheid wusste, steht ganz außer Frage.
Mai 1936. Im Gemeindehaus, Blankeneser Bahnhofstraße Nr. 46, wird,
unter der Oberaufsicht von Schetelig, ein für neun Gemeinden
zuständiges zentrales Kirchenbuchamt eingerichtet. Es gibt
bereitwillig Auskunft über Stammbäume und stellt die begehrten
„Arier“-Ausweise aus. Vor allem aber liefert es den staatlichen
Sippenämtern die verlangten Informationen über sog. „Voll“-, „Halb“-
und „Vierteljuden“ und wird damit zu einem der vielen Rädchen in der
Maschinerie der „Endlösung“. Und so geht es fort – immer weiter der
Shoa entgegen.
Die Blankeneser Pastoren bleiben aktiv – 1937, 1938, 1939, 1940. Kein
einziges Contra von ihnen gegen das rigide Vorgehen des Staates gegen
die Juden war bisher in den Dokumenten bisher zu finden. Nach unserer
Kenntnis gab es in Blankenese auch kein Mitglied der Beken-nenden
Kirche, jener Organisation, die – zumindest theoretisch – wenigsten zu
den getauften Juden stehen wollte. Ganz im Gegenteil: Schetelig, das
ist belegt, sprach sich entschieden gegen die Bekennende Kirche aus.
Dezember 1941: Schetelig zeichnet ein Schreiben ab, das vom
evangelisch-lutherischen Kirchenamt an alle Synodalausschüsse
verschickt worden war. Darin steht: „Durch die christliche Taufe wird
an der rassischen Eigenart eines Juden, seiner Volkszugehörigkeit und
seines biologischen Seins nichts geändert. Eine deutsche evangelische
Kirche hat das religiöse Leben deutscher Volksgenossen zu fördern.
Rassejüdische Christen haben in ihr keinen Raum und kein Recht.“
Kein Raum und kein Recht. Von den in Blankenese zu dieser Zeit noch
lebenden Juden, die nicht rechtzeitig ins Ausland geflohen waren, zum
Teil nicht fliehen konnten, wurden 31 im KZ ermordet, zehn begingen
vor der ihnen drohenden Deportation Selbstmord, nur zwei Deportierte
überlebten.
Was war nach Kriegsende? Kein Bedauern, keine Scham, von Demut keine
Spur in der Blan-keneser Kirche. Nein - der Spieß wird jetzt
umgedreht: Es wird statt über Demut über Demütigung gepredigt. Die
Täter machen sich selber zu Opfern. Im Juli 1945, eben nach
Kriegsende, predigt Schmidt über den Psalm:“...Wenn du mich demütigst,
machst du mich groß.“ Nicht etwa von den Juden ist in dieser
Bibelstunde die Rede, sondern von denen, die an den
Nationalsozialismus geglaubt, auf ihn gehofft hatten. Jetzt, sagt
Schmidt, lägen sie am Boden. Das äußere Glück, das sie sicher gemacht,
an das sie ihre Seelen verloren hätten, sei nun zusammengestürzt.
„Was werden wir tun“, fragt Schmidt und spielt dabei wohl auch auf den
„Schmach-Frieden“ nach dem verlorenen 1. Weltkrieg an, „was werden wir
tun, wenn es wie-der hinabgeht in das Tal der Demütigungen?“ Daß sie,
die Pastoren, es zusammen mit den andern waren, die die Juden zutiefst
gedemütigt und sie in den Dreck gezerrt haben, kommt ihm nicht in den
Sinn. Oder gerade doch?
Man möchte verstehen: War die Schuld zu groß, um sich ihr stellen zu
können? Deshalb die Abwehr? Möglicherweise. Es sei, so erforschten
Psychoanalytiker wie Alexander Mitscherlich und Tilmann Moser, für die
am Judenmord Schuldigen und Mitschuldigen ebenso schwer, die vielen
Schichten ihrer Abwehr zu durchbrechen, wie für die Opfer, deren
Kinder und Enkel manchmal heute noch nicht davon sprechen können,
welches Grauen ihre Eltern oder Großeltern durchgemacht haben. Die
Angst davor, zu wissen – auf beiden Seiten?
Pastor Richard Schmidt schied 1946 aus dem Amt, aus Altersgründen.
Über ihn ist in der Gemeinde-Chronik von 1996 lobend vermerkt: „Seine
volksnahe Arbeit hatte bei Alt und Jung großen Anklang gefunden.“
Propst Wilhelm Schetelig blieb bis zu seinem Tod am 6. Oktober 1952
tätig. Er starb, wie in derselben Kirchen-Chronik nachzulesen ist,
„nach 23-jähriger segensreicher Arbeit.“
Dies große Verschweigen ist es, das den Menschen zu schaffen macht:
den Kindern und Enkeln der Opfer, aber auch, davon berichten
Psychologen, den Kindern und Enkeln der Täter und Mittäter.
‚Entnazifizierung: bei uns nicht erforderlich!’, so hatte der
Kirchenvorstand 1946 nach dem Zusammenbruch befunden. Solches Schönen
ist es, an dem die Seele Schaden nimmt. Nicht nur die Seele jedes
einzelnen, auch die einer ganzen Institution wie die der Blankeneser
Kirche. Jetzt, 60 Jahre später, hat sie ihr Schweigen endlich brechen
können. Hat damit begonnen, sich zu erinnern. Erinnerung ist nicht
neutral. Sie braucht keine Überheblichkeit, aber sie braucht
Klarheit, und sie fordert die Stellungnahme heraus. Diese hat nun –
nach auch heute noch zähem Ringen - in dem Entwurf eines
Schuldbekenntnisses der Blanke-neser Kirchengemeinde ihren Ausdruck
gefunden. Darin heißt es – ich zitiere auszugsweise:
„Mit Scham schauen wir auf das, was gewesen ist... Wir stellen uns der
Verantwortung, die uns die Vergangenheit auferlegt und erkennen das
Versagen jener Zeit als Schuld, die bis heute auf unserer Gemeinde
lastet...
Wir erkennen und bekennen,
dass die Kirchengemeinde Blankenese... einen opportunistischen Weg
eingeschlagen hat;
dass sie sich... nicht dem Druck der Ereignisse gebeugt, sondern den
neuen Zeitgeist „freudig begrüßt“ hat;
dass sie ihre theologische Mitte durch die Vermischung christlicher
Predigt mit nationalso-zialistischem Gedankengut verloren hat;...
dass ein alter, tief in der lutherischen Kirche und in unserer
Gemeinde verwurzelter Antijudaismus der Nährboden für den „modernen“
Antisemitismus war und ist;...
dass die Bereitstellung des Kirchenbuchamtes in Blankenese... einen
aktiven Beitrag zur nationalsozialistischen Rassenpolitik darstellte.
Mit Schrecken denken wir daran, dass jüdische Mitbürger aus Blankenese
so möglicherweise durch kirchliche Mithilfe umgekommen sind....
Wir erkennen und bekennen dies als Schuld....“
Gibt es Bewegenderes, was eine Ausstellung anstoßen könnte, als dieses
Bekenntnis?
Vielen Dank.
Marion Rollin, Blankenese, 12. Mai 2004
|
|
 | |  |